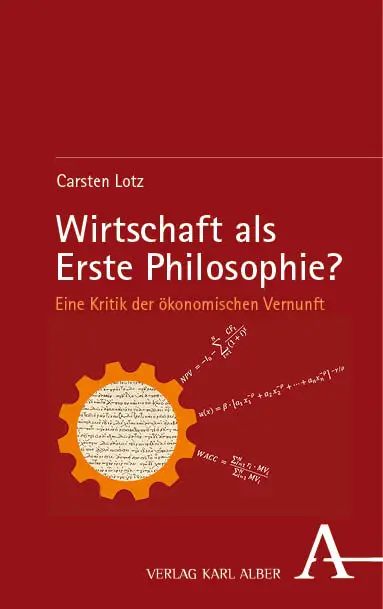Unsere Welt ist durchzogen von ökonomischem Denken und Handeln. Die Ökonomie hat sich längst weit über den gesellschaftlichen Bereich der Wirtschaft und der Unternehmen hinaus ausgebreitet; kein Gesellschaftsbereich mehr, der nicht in den vergangenen Jahrzehnten einer ökonomischen Bewertung und Optimierung ausgesetzt gewesen wäre: „It’s the economy, stupid!“ rief Bill Clinton im Jahr 1992 seinen Wählern zu. Die Ökonomie ist zur „Ersten Philosophie“ geworden und Wohlstand zu dem Maßstab, nach dem wir unser Denken und auch Handeln ausrichten: Bildung ist gut, weil sie individuellen und gesellschaftlichen Wohlstand schafft; Wettbewerb ist gut, weil er Innovation fördert, die Wohlstand schafft; Diversität ist gut, weil diverse Unternehmen höhere Profite erwirtschaften, was Wohlstand schafft. – Die Liste ließe sich fortsetzen.
Das Ergebnis ist eine Mehrung des solchermaßen ins Zentrum gerückten Wohlstands, die vor 200 Jahren nicht in Ansätzen vorstellbar gewesen wäre. Die Mittelschicht in westlichen Ländern führt ein besseres Leben als der reiche Adel der frühen Neuzeit; und immer breitere Bevölkerungsgruppen in aufstrebenden Ländern schließen auf. Allerdings sehen wir auch die Schattenseiten einer um sich greifenden Ökonomisierung: Die Klimakrise und das Artensterben führen uns vor Augen, dass wir auf fremde Rechnung gewirtschaftet haben. Adipositas und psychische Krankheiten sind Auswirkungen einer Wirtschaftswelt, die zu immer mehr verführt und gleichzeitig immer mehr verlangt. Das Auseinanderklaffen von kurzfristigen Marketing-Versprechen und mittelfristig erlebter Realität führt zudem zu Radikalisierungen der Politik.
Die Vorschläge, die zur „Rettung des Systems“ vorgebracht werden, versuchen entweder dessen Probleme mit seinen eigenen Methoden zu lösen (Long-term capitalism, CSR, etc.) oder aber stellen den marktwirtschaftlichen Ansatz in Summe in Frage, ohne eine Alternative anbieten zu können, die nicht schon einmal ihr Scheitern dokumentiert hätte. Seit dem von Francis Fukuyama diagnostizierten „Ende der Geschichte“ scheint es, als gebe es keine Auswege mehr. Herrschen auch in Peking, Riad und Washington unterschiedliche politische Systeme, so funktioniert Wirtschaft doch überall nach denselben Regeln. Die von den europäischen Aufklärern propagierte universelle Freiheit verwirklichte sich letztlich als ökonomische Freiheit. – Doch bedeutet die scheinbare Alternativlosigkeit auch, dass alle gesellschaftlichen Bereiche der ökonomischen Logik folgen müssen?
Das Buch widersetzt sich dieser These. In drei Teilen legt es dar, wie eine spezifische Lesart der Philosophie der Moderne dem ökonomischen Denken Pate stand und es nunmehr seit fast 300 Jahren prägt. Das ökonomische Denken ist egozentrisch, gegenwartsfixiert und systemorientiert. Es konnte sich durchsetzen, weil es sich nahtlos mit unserem alltäglichen Denken verbindet und zudem Entscheidungsprozesse radikal vereinfacht. Stabilisiert wird es durch eine neue Managementklasse, die längst nicht mehr nur Unternehmen managet, durch gesellschaftliche Diskurse, die uns die Ökonomie als Lösung jedes Problems vorstellen, und durch quasi-religiöse Elemente, die einen neuen Sinn anbieten. Das Buch zeigt auf, in welche Aporien wir uns mit dem ökonomischen Denken hineinmanövrieren und wie wir anders denken könnten und müssten, um gesellschaftlich wieder anders handeln zu können.
Die ökonomische Vernunft als neue Erste Philosophie
Der erste Teil verfolgt den Aufstieg der ökonomischen Vernunft ausgehend von Leitgedanken der Moderne: Autonomie des Subjekts, Gegenwartsfixierung und Systemdenken. Der Aufstieg des selbstbewussten Subjekts wird mit René Descartes’ Meditationen zur Ersten Philosophie und Fichtes Gedanken zur Selbst-Setzung des Ich nachvollzogen. Für die Zeitmächtigkeit des Bewusstseins und die Reduktion der Zeit auf die Gegenwart dienen Augustinus und Edmund Husserl als Referenzautoren. Zugleich wird dem modernen Bewusstsein die Zeit knapp, was mit Martin Heidegger gezeigt wird. Dass die Welt für die Moderne grundsätzlich rational und einer Systematisierung zugänglich ist, dafür stehen exemplarisch Georg Friedrich Wilhelm Hegel sowie auch noch einmal Husserl.
Eine Lektüre der ökonomischen Ideengeschichte zeigt, wie sich diese philosophischen Perspektiven in der theoretischen wie praktischen Wirtschafts- und Managementlehre fortentwickeln und über das enge Feld der Wirtschaft und der Unternehmen hinaus Einfluss gewinnen. Mit Autoren wie Hermann Heinrich Gossen, Gary Becker, Frederick Taylor oder Milton Friedman wird die Weiterentwicklung des ökonomischen Gedankengebäudes, seine Durchsetzung zunächst in der Wirtschaft und schließlich in anderen gesellschaftlichen Bereichen beschrieben. Das Subjekt der modernen Philosophie wird zum homo oeconomicus, die Gegenwart zum Net Present Value und das Denksystem zum Management-system. Die ökonomische Logik wird in anderen gesellschaftlichen Bereichen bereitwillig übernommen, wie die Privatisierungen ehemals öffentlicher Dienstleistungen und die Selbst-Ökonomisierung von Sport und Kunst zeigen.
Der erste Teil schließt mit einer Untersuchung der Konsequenzen. Mit Niklas Luhmann lässt sich zeigen, wie sich die Ökonomie als gesellschaftliches Teilsystem stabilisiert und warum sie dadurch auch zum stabilisierenden Faktor des Gesamtsystems wird. Sie ist für diese Stabilisierung inhärent zu Wachstum gezwungen (Mathias Binswanger), das sich bei genauerer Analyse als Beschleunigungszwang entpuppt, dem sich alle gesellschaftlichen Bereiche ausgesetzt sehen. Er wird als ein übergreifendes Kennzeichen der Moderne verstanden (Hartmut Rosa). Manche Theoretiker treten die Flucht nach vorn an und preisen den „Accelerationism“ als Lösung der Brüche der Moderne (Gilles Deleuze, Mark Fisher, Nick Land), was jedoch nur in Teilen überzeugt. (Benjamin Noys)
Die Stabilisierung der Ökonomie als gesellschaftliches System
Der zweite Teil analysiert die Herrschaftsmechanismen des ökonomischen Denkens. Er argumentiert, dass wir in breiten Teilen nicht nur die Fähigkeit verloren haben, anders zu handeln, sondern vor allem auch die Fähigkeit, anders zu denken. Die Ökonomie hat sich in einer Weise als Erste Philosophie etabliert, die anderes Denken verdrängt. Drei maßgebliche Elemente lassen sich benennen.
Erstens. Entgegen der Diagnose, dass die großen Erzählungen am Ende seien (Lyotard), ist es dem ökonomischen Denken seit rund 50 Jahren gelungen, ihnen gleichsam lebensverlängernde Maßnahmen zukommen zu lassen. Der freie Verkehr von Personen und Waren hat das Freiheitsversprechen in Teilen eingelöst, die Emanzipation der Arbeiter wurde durch eine Neudefinition des Eigentumsbegriffs unnötig, an die Stelle der Bereicherung aller ist ein neues Verständnis von Gerechtigkeit als Fairness (John Rawls) getreten, und das Heil der Kreaturen wird in Nachhaltigkeit und Purpose gesucht, die mit wirtschaftlichen Kennzahlen akribisch verfolgt werden.
Zweitens. Mit dem „Management“ hat die Ökonomie ihre eigene herrschende Klasse herausgebildet, die nicht nur weltweit gleichen Codes folgt, sondern mit dem Gedanken der „Meritokratie“ auch über ihre eigene Gründungserzählung verfügt. Durch Schulen, Universitäten, Lobby- und Interessensvereinigungen verfestigt sie ihre Existenz als gesellschaftliche Institution. Sie hat ein eigenes kulturelles Kapital herausgebildet, das den klassischen Bildungskanon ablöst und identitätsbildend wirkt. Gleichzeitig ist sie fluider und durch ihre Verwobenheit mit der „Mittelschicht“ weniger angreifbar als frühere Herrschaftsklassen. In Teilen fehlt ihren Angehörigen gar das Bewusstsein dazuzugehören.
Drittens. Die Beschreibung des Kapitalismus als Religion verdanken wir Walter Benjamin. Doch der Charakter der Unterbrechungslosigkeit und der Verschuldungsdynamik ist erst heute vollends zu Tage getreten. Der öffentliche kapitalistische Kult wird zudem ergänzt und gestützt durch die private spirituelle Praxis der Achtsamkeit. In einer säkularisierten und entkernten ehemals buddhistischen Lehre sucht das Selbst nicht sein Verlöschen, sondern seine Stärkung. Die ehemals religiöse Ausrichtung auf den Anderen bis zur Hingabe wird ersetzt durch konstante Selbstbestätigung und Selbstoptimierung.
Jenseits der Ökonomie?
Der dritte Teil sucht nach Brüchen im modernen Denken, aber auch im ökonomischen Handeln. Er zeigt auf, wo das ökonomische Denken theoretisch-logisch versagt und welche Optionen wir hätten, anders zu denken und anders zu handeln. Es gibt angesichts der Krisen nicht nur die Notwendigkeit, Gesellschaft anders zu gestalten, sondern wir haben alles in der Hand, um es auch zu tun.
Wo Zahlungen Beziehungen ersetzen, löst sich die auf Dauer angelegte Gesellschaft auf. Die Autonomie des Subjekts geht verloren, da der Raum, in dem Autonomie gewonnen werden kann, nicht mehr stabil ist. Durch die Abzinsung der Zahlungen auf ihren heutigen Wert, entwerten wir die Zukunft. In Verbindung mit der Illusion des Geldes, alles sei durch alles ersetzbar und unendlich vermehrbar, nehmen wir unseren Kindern ihre Lebensgrundlagen von Natur und gesellschaftlicher Infrastruktur. Aber auch heute schon erhöhen wir das Risiko im System. Die Krisenhäufigkeit der letzten Jahre ist kein Zufall, sondern strukturell im System angelegt.
Doch wir könnten anders denken. Wir könnten das Subjekt nicht als homo oeconomicus, sondern mit Emmanuel Levinas als sub-iectum, als unterworfen unter den Anspruch des anderen verstehen, als Subjekt, das erst durch die Verantwortung für den anderen Subjekt wird. Wir könnten die Zeit nicht als begrenzenden und zu optimierenden Faktor, sondern als Ausdruck der Beziehung zum anderen betrachten. Und wir könnten mit Marcel Mauss und Jaques Derrida begreifen, dass jeder Tausch mit einer Gabe beginnt, die ein Leben jenseits der ökonomischen Illusion der Knappheit ermöglicht.
Wenn wir so dächten, dann ließen sich Bedingungen für ein anderes gesellschaftliches Miteinander formulieren, die begründet Ausnahmen vom Zugriff des Ökonomischen definieren: Bildung und das Bankenwesen, Kunst und kritische Presse, Infrastruktur und Pflege wären solche Bereiche. Wir würden die Rolle von Anreizmechanismen in Frage stellen, die uns ständig Knappheit suggerieren, wo wir im Überfluss leben. Und wir würden uns trauen, Bildung und Erziehung wieder auf Mündigkeit (Adorno) statt auf Verwertbarkeit auszurichten.
Zurück zur Buchübersicht.
Zum Inhaltsverzeichns.